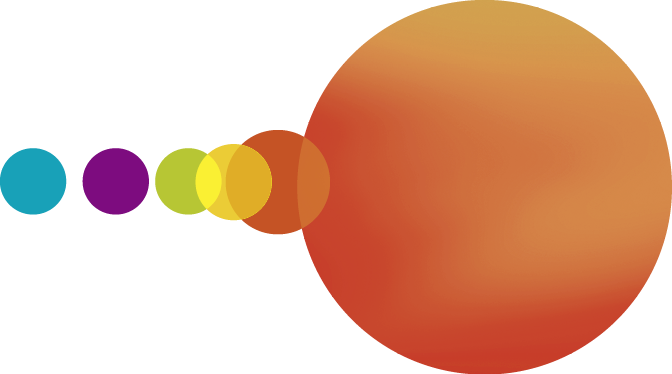Über den Report
So wie in den letzten Jahren haben wir auch 2022 mit Hilfe des zd-Boards die Umfrage zum Digitalisierungs- und Technologiereport durchgeführt, welche in dem D.U.T Report 2023 zusammengefasst sind. Bei dieser Umfrage konnten wir 336 Diabetologen, Diabetologinnen und 647 Diabetesberater-/innen/-assistentinnen zu ihren Einstellungen, Meinungen und Prognosen hinsichtlich der Digitalisierung und neuen Technologien befragen. Während in den Jahren davor die Firma Berlin Chemie diese Umfrage unterstützte, wurde diese Umfrage ohne finanzielle Unterstützung durch das Forschungsinstitut der Diabetes-Akademie Bad Mergentheim (FIDAM) durchgeführt.
Vorwort der Herausgeber
Die Ergebnisse zeigen, dass die Einstellung zur Digitalisierung nach wie vor sehr positiv ist. Beide Berufsgruppen erwarten, dass hiermit bei Menschen mit Diabetes sowohl eine bessere Therapieeinstellung als auch eine Reduktion diabetesbezogener Belastungen erreicht werden kann. Allerdings werden durch neue Technologien auch neue Herausforderungen, Belastungen geschaffen, die es zu berücksichtigen gilt.
Bei der Anzahl neuer Technologien ist auch in diesem Jahr eine deutliche Steigerung zu beobachten. Besonders auffällig ist in diesem Jahr die Zunahme von Systemen zur automatisierten Insulinabgabe (AID-Systeme), die mittlerweile bei 12% aller Menschen mit Typ-1-Diabetes Anwendung finden. Mittlerweile ist auch die Methode der kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) in der Therapie des Typ-1-Diabetes Standard (77%) und wird zunehmend auch bei Menschen mit Typ-2-Diabetes (22%) angewendet.
Durchschnittlich 69,0 % der Patienten mit Typ-1-Diabetes sind nach Meinung der Diabetologen für die Anwendung eines AID-Systems (unabhängig der Erstattungsmodalitäten der Krankenkassen) geeignet und schätzen, dass 58 % der Menschen mit Typ-1-Diabetes und 13 % mit Typ-2-Diabetes in 5 Jahren ein AID-System benutzen werden. Ähnlich sind die Schätzungen der Diabetesberater-/innen/-assistenten/innen: Sie glauben, dass 66 % der Patienten mit Typ-1-Diabetes für die Anwendung eines AID-Systems geeignet sind. Ihre Schätzung in 5 Jahren ist ähnlich wie die Diabetologen: 61 % der Menschen mit Typ-1-Diabetes, 15 % der Patienten mit Typ-2-Diabetes. Es ist daher zu erwarten, dass AID-Systeme in den nächste 5 Jahren deutlich mehr Verbreitung gewinnen werden.
In der Umfrage wurde auch nach Barrieren bei der Anwendung von AID-Systemen in der klinischen Praxis gefragt. Hier zeigte sich, dass vor allem auf Seite der Praxis, der Aufwand, ständig „up-to-date“ zu bleiben als herausfordernd erlebt wird und auf Patientenseite das Fehlen von Schulungsangeboten, – programmen zu modernen Technologien bemängelt werden.
Sicher aufgrund mangender rechtlicher Rahmenbedingungen bzw. Vergütungsmöglichkeiten wird die Videosprechstunde, als auch die Videoschulung nur selten in der klinischen Praxis angewendet. Interessant ist auch die Einschätzungen zu Apps, die im Moment eher noch eher skeptisch beurteilt werden.
In der Zukunft erwarten sowohl die befragten Diabetologen als auch die Diabetesberater-/innen/-assistent-/innen einen deutlichen Zuwachs moderner Technologien. Wir hoffen, Ihnen mit diesen Umfrageergebnissen eine Orientierung gegeben haben, wie die neuen Digitalisierungstrends in der Diabetologie von den Befragten beurteilt und welche Zukunftsoptionen gesehen werden. Denn frei nach dem griechischen Philosophen Heraklit: „Nichts ist beständiger als der Wandel“.

 Prof. Dr. Bernhard Kulzer
Prof. Dr. Bernhard Kulzer
Bad Mergentheim
Prof. Dr. Lutz Heinemann
(Düsseldorf/San Diego)
Vorwort DDG
Der Einsatz und die Nutzung neuer Technologien durch Menschen mit Diabetes hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Während eine Sensor-unterstützte Insulinpumpentherapie noch vor wenigen Jahren als innovativ galt, wird diese Technologie inzwischen überholt durch kommerziell verfügbare AID-Systeme. Zunächst fokussierten sich die technischen Innovationen auf den Typ 1 Diabetes-Bereich, mittlerweile nutzen zunehmend mehr Menschen mit Typ 2 Diabetes ebenfalls ein CGM-System und damit moderne Technologien. Die Einstellung zur Digitalisierung – sowohl auf Seiten der Betroffenen als auch auf Seiten der Therapeuten – hat sich in den letzten Jahren deutlich zum Positiven verändert. Zweifellos stellt diese Nutzung auch eine Herausforderung dar: Der Schulungsaufwand ist hoch, nicht wenige Patienten aber auch Diabetes-Teams fühlen sich überfordert mit der Geschwindigkeit solcher Innovationen.
Der DUT Bericht 2023 legt eindrucksvoll und faktenbasiert dar, wie sich die technischen Veränderungen im Diabetes-Bereich auswirken. Er deckt damit auch die Defizite auf, die es im Umgang mit dieser Entwicklung gibt. Damit ist dieser Report eine wichtige Datengrundlage für die Entwicklung zukunftsfähiger, optimierter Strategien im Umgang mit neuer Technik.
Abermals ist es den Herausgebern gelungen, eine wichtige und aktualisierte Standortbestimmung vorzunehmen. Ihnen, Prof. Dr. Bernhard Kulzer und Prof. Dr. Lutz Heinemann, gilt mein Glückwunsch für diese gelungene und abermals lesenswerte Neuauflage des DUT Berichts.
 Prof. Dr. Andreas Neu
Prof. Dr. Andreas Neu
Pastpräsident der
Deutschen Diabetes Gesellschaft
10.05.2023
Vorwort VNDN
Diabetestechnologie, insbesondere AID Systeme (Systeme zur automatischen Insulindosierung), etablieren sich immer mehr in der Versorgung von Menschen mit Diabetes.
Diabetesteams technologisch fit für die Zukunft machen, ist das aktuelle Anliegen vieler Verbände, so auch des VNDNs.
Für die große Herausforderung, Wissen zu Diabetestechnologie in die breite Versorgungsebene, sowohl stationär als auch ambulant zu bringen, benötigen wir gute Ideen, viel Enthusiasmus, Fortbildungskonzepte für Fachpersonal, Schulungen für Menschen mit Diabetes und vielleicht ein wenig positive Verrücktheit, denn regulatorische Prozesse verkomplizieren den täglichen Umgang mit der Technologie.
Der D.U.T Report beschreibt seit Jahren die positive Grundeinstellung zur Technologie von Diabetesteams. Auch in der aktuellen Umfrage ist die Zustimmung zur Anwendung von neuen Technologien wieder groß. Mut, etwas Neues auszuprobieren, zu starten oder verstehen zu wollen, ist für Diabetesteams offensichtlich überhaupt kein Problem. Und das ist phantastisch!

Sandra Schlüter
Vorstandsvorsitzende des Verbands der niedergelassenen Diabetologen Niedersachsens (VNDN)
Vorwort VDBD
Zum zweiten Mal beteiligten sich VDBD-Mitglieder in erfreulicher Zahl an der Umfrage zum D.U.T. Report. Und zum zweiten Mal bestätigten die Ergebnisse nicht nur die positive Einstellung von Diabetesberater:innen und Diabetesassistent:innen zur Diabetestechnologie, sondern auch ihre Kompetenzen in puncto CGM, Insulinpumpe, Smart-Pen und AID-Systemen.
Angesichts der digitalen Transformation des Gesundheitswesens sind Diabetesberater:innen und Diabetesassistent:innen gefordert, die eigene Qualifikation kontinuierlich durch adäquate Fortbildungen zu erweitern und gleichzeitig die technologischen Erneuerungen in das eigene berufliche Handeln zu integrieren. Auch telemedizinische Kompetenzen werden in naher Zukunft an Bedeutung zunehmen. Dafür müssen entsprechende zeitliche Freiräume und finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Daher ist es sehr bedauerlich, dass beispielsweise nach wie vor keine bundesweite Vergütungsregel für Online-Patienten-Schulungen existiert, obwohl Diabetesverbände dies aufgrund der Erfahrungen während der Pandemie nachdrücklich fordern.
Umso wichtiger ist es, digitale bzw. telemedizinische Kompetenzen in der Vergütung von Diabetesfachkräften abzubilden. Nicht zuletzt deshalb bringt sich VDBD auch politisch in die übergeordnete Diskussion zur Digitalisierung des Gesundheitswesens ein. Anlass für das jüngste VDBD-Positionspapier war u.a. die Gesetzesinitiative der EU Kommission für einen Europäischen Gesundheitsdatenraum aus dem Mai 2022 sowie die Digitalisierungsstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit aus dem März 2023. Der VDBD begrüßt grundsätzlich die europäischen und nationalen Pläne zur Förderung der Primärnutzung digitaler Gesundheitsdaten durch Patient:innen und Behandlungsteams sowie der Sekundärnutzung durch Forschung, Innovation und Politik.
Ein zentrales Instrument in diesem Kontext ist die elektronische Patientenakte (ePA). Der VDBD unterstützt das von der Bundesregierung vorgeschlagene Opt-Out-Prinzip, so dass nicht die Bürger:innen in der Pflicht stehen, sich zu registrieren, sondern eine ePA automatisch erhalten oder ggf. aktiv widersprechen können. Um die Vorteile mobiler digitaler Gesundheitsdaten zum Wohle der Patient:innen nutzen zu können, sind auch Gesundheitsfachberufe, wie z.B. Diabetesberater:innen, in die Zugangsregeln zur ePA einzubeziehen.
Die Akzeptanz der ePA wird entscheidend von den Regelungen für Datenschutz, Daten- und Rechtssicherheit, aber auch davon abhängen, ob nützliche Informationen gespeichert werden und die Nutzung für Patient:innen unkompliziert gestaltet wird. Gemäß des Transparenzprinzips sollten aus Sicht des VDBD Patient:innen unmittelbar auf ihre eigenen Gesundheitsdaten, wie z.B. Untersuchungsergebnisse, zugreifen können. Das bedeutet, dass Leistungserbringer die Gesundheitsdaten zeitgleich Patient:innen zur Verfügung stellen.
Erst im Alltag der Patientenversorgung beweist sich, ob digitale Anwendungen als innovativ und hilfreich oder als Belastung wahrgenommen werden. Das gilt sowohl für Patient:innen als auch Behandlungsteams. Mit anderen Worten: Digitalisierung ist Instrument und nicht Ziel der Modernisierung des Gesundheitswesens. Die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit digitaler Anwendungen, inklusiver lernender Systeme (KI), sind an deren Mehrwert für Lebensqualität, Patientenversorgung und -partizipation sowie für eine Entlastung der Gesundheitsberufe zu messen.

 Dr. Nicola Haller
Dr. Nicola Haller
Vorsitzende des Verbands der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. (VDBD)
Dr. Gottlobe Fabisch
Geschäftsführerin des Verbands der Diabetes-
Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e.V. (VDBD) und der VDBD AKADEMIE GmbH