Prof. Dr. Lutz Heinemann
Technologie: Innovative Entwicklungen
Praktisch täglich wird über neue Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung und Technologie bei der Diabetestherapie berichtet. Es wird gelten, die Balance zu finden zwischen der zügigen Implementierung „echter“ Innovationen versus überhasteter Nutzung von Scheininnovationen.
Die hohe Entwicklungsgeschwindigkeit im Bereich der Digitalisierung und Diabetestechnologie (DT) ist durch verschiedene Faktoren bedingt: Eine der Haupttriebfedern ist neben der Bereitschaft zu erheblichen finanziellen Investitionen durch die verschiedenen Player die ständig steigende Anzahl von Patienten bei gleichzeitig abnehmender Anzahl an Diabetologen. Ein konkreter Schritt in diese Richtung kann eine deutliche Reduktion bei vielen Standardaufgaben in der Patientenbetreuung bedeuten, wenn sie an automatisch im Hintergrund ablaufende Computerprogramme delegiert werden. Solche „Expertensysteme“ liefern Ärzten und Patienten konkrete Hinweise zur Therapieadjustierung durch eine geeignete Analyse aller verfügbaren Daten. Damit soll auch in Zukunft Zeit für eine gute und persönliche Patienten-Arzt-Interaktion bleiben.
Im Folgenden werden aktuelle Entwicklungen aus verschiedenen Bereichen in der Diabetestherapie betrachtet, dabei werden diese mehr aus strukturierenden Gründen in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Das Zusammenführen der Daten aus verschiedenen Quellen stellt ein übergeordnetes Phänomen aller innovativen Ansätze dar, es gilt, die Gesamtheit der Entwicklungen zu sehen. Als Hauptschwierigkeit für die Implementierung solcher innovativen Ansätze in die praktische Patientenbetreuung müssen die dabei entstehenden Kosten gesehen werden – viele Kostenträger sind ohne klare Belege für die Evidenz von deren Einsatz nicht bereit, für Patienten mit Diabetes einen immer größer werden Teil ihrer Gesamtaufwendungen auszugeben.
Müllvermeiden wird ein Thema
Ebenfalls im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang ist zu sehen, dass „Green Diabetology“ zunehmend ein Thema wird, insbesondere, wenn es um Müllvermeiden geht. Es ist schlicht erschreckend, welche Mengen an Plastikmüll beim Wechseln eines Glukosesensors oder eines Infusionssets anfallen. Klar gilt es, hierbei regulatorische Vorgaben zu berücksichtigen, trotzdem wird durch mehr Aufmerksamkeit bei der Entwicklung neuer Produkte einiges zu erreichen sein, und offenbar gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Ländern innerhalb der EU und den Kontinenten (EU vs. USA), welche Bedeutung diesem Thema beigemessen wird.
Diagnostische Optionen – SMBG
Stand der Dinge: Die technische Entwicklung bei Messgeräten für die Selbstmessung der Blutglukose (SMBG) hat einen beachtlichen Reifegrad erreicht. Dabei ist die Bandbreite an Messgüte, die die Geräte der verschiedenen Hersteller aufweisen, ebenfalls beachtlich.
Wirklich neue Messprinzipien werden bei der SMBG wohl nicht mehr in den Markt eingeführt.
Es gibt Geräte, deren Messgüte mit der von Laborgeräten vergleichbar ist, und gleichzeitig Geräte, deren Nutzung für Patienten ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellen, da die Messergebnisse nicht zuverlässig sind. Wirklich neue Messprinzipien werden bei der SMBG aber wohl nicht mehr entwickelt bzw. nicht mehr in den Markt eingeführt, obwohl der SMBG-Markt immer noch ein Volumen von vielen 100 Mio. € pro Jahr aufweist.
In den hoch entwickelten Ländern nutzt ein großer Teil der Patienten mit Typ-1-Diabetes inzwischen Systeme zum kontinuierlichen Glukosemonitoring (CGM), während unter den Patienten mit Typ-2-Diabetes bisher nur relativ wenige ihren Glukoseverlauf damit verfolgen. In anderen Ländern wird SMBG noch häufiger verwendet, wohl auch aus Kostengründen. Insgesamt gibt es einen klaren Trend zu CGM-Systemen, die keine Blutzuckermessung mehr zur Kalibrierung benötigen.
SMBG wird also nicht ganz verschwinden vom Markt für Glukosemonitoring, aber die Verhältnisse werden sich hin zu CGM-Systemen verschieben. Die Geschwindigkeit, mit der die Verschiebung erfolgt, wird vor allem von den Kosten getrieben werden. Sobald es CGM-Systeme gibt, deren Kosten mit heutigen SMBG-Systemen vergleichbar sind, werden die Kostenträger diese vermutlich übernehmen.
Insgesamt gibt es einen klaren Trend zu CGM-Systemen, die keine Blutzuckermessung mehr zur Kalibrierung benötigen.
Innovative Ansätze: Selbst wenn die Patienten ihre Blutglukosekonzentration nur einige Male pro Tag messen (primär zum Festlegen der prandialen Insulindosis), ergibt dies über die Zeit hinweg diverse Messwerte. Die Werte werden üblicherweise direkt im Messgerät dokumentiert und können von dort automatisch an ein Smartphone übertragen oder in die Cloud hochgeladen werden. Die Verfügbarkeit dieser SMBG-Daten ermöglicht eine Analyse durch Apps oder durch „Patient Decision Support Software (PDSS)“: Diese Programme unterstützen die Patienten bei der geeigneten Therapiedurchführung z. B. durch Hinweise auf bestimmte Muster in den Glukoseverläufen, was zu einer Verbesserung der Glukosekontrolle führen kann. Durch die Nutzung zusätzlicher Informationen, die z. B. Smart-Pens (s. u.) zur Insulintherapie liefern, oder durch „Wearables“ (Fitnesstracker) zum Bewegungsverhalten, kann das Diabetesmanagement weiter optimiert werden.
Den Nutzen nachweisen
Wie bereits erwähnt, ist es notwendig, den konkreten Nutzen solcher Ansätze für Patienten und deren Behandler durch klinische Studien nachzuweisen. So belegen die Ergebnisse des ProValue-Studienprogramms, dass eine strukturierte und systematische Nutzung von SMBG-Daten zu einer deutlichen Verbesserung bei der Glukosekontrolle und bei den Patient-Reported Outcomes der Studienteilnehmer führte. Eine Auswertung der Kosten für eine derartig optimierte Betreuung belegt ebenfalls die Sinnhaftigkeit dieses Ansatzes. Durch eine „smarte“ Datennutzung und den Einsatz digitaler Tools wird nicht nur das Diabetesmanagement verbessert, Patienten fühlen sich auch wohler und sicherer.
Was gilt es zu tun? Vielen Patienten und ihren Behandlern ist die Güte des Diabetesmanagements, die durch geeignete Nutzung von SMBG-Daten erreicht werden kann, nicht ausreichend klar. Die Digitalisierung bietet bei SMBG, auch bei einer im Vergleich zu CGM-Systemen knapperen Datenlage, einiges an Optimierungspotenzial – bei moderaten Kosten!
Diagnostische Optionen – CGM
Stand der Dinge: Nach einem relativ langsamen Start haben sich CGM-Systeme auf dem Markt etabliert; vor allem viele der Patienten mit Typ-1-Diabetes nutzen diese. Dies ist auch möglich, weil es seit einigen Jahren eine Kostenerstattung für rtCGM-Systeme durch die gesetzlichen Krankenversicherungen gibt, seit Kurzem auch für die aktuelle Generation des iscCGM-Systems. Ein weiterer wichtiger Schritt war, dass Therapieentscheidungen nun aus regulatorischer Sicht auf CGM-Messergebnissen beruhen dürfen, zumindest gilt dies für einige CGM-Systeme.
Marktzahlen belegen, dass die Nutzung von CGM-Systemen schneller ansteigt als die von Insulinpumpen, was auch bedeutet, dass Patienten mehr über ihren aktuellen Glukoseverlauf kennen wollen, als die Option einer flexibleren Insulintherapie haben zu wollen. Dies gilt sowohl für die CGM-Systeme (bei denen die Glukosemesswerte automatisch und direkt an ein Empfangsgerät übertragen werden wie bei den rtCGM-Systemen) als auch beim iscCGM-System, bei dem die Patienten die gemessenen Glukosewerte durch intermittierendes Scannen (isc) mit dem Empfänger oder einem Smartphone aus dem Sensor auslesen; von diesem System gibt es nun eine zweite Generation mit Alarmfunktion. Die ausgesprochen hohe Akzeptanz dieses iscCGM-Systems durch die Patienten hat zu weltweit mehr als 1,5 Millionen Nutzern geführt.
Die bisherigen CGM-Systeme verwenden einen Nadelsensor, der durch die Haut in das subkutane Fettgewebe eingestochen wird. Gemessen wird die Glukosekonzentration in der interstitiellen Gewebeflüssigkeit. Bei einem neuartigen rtCGM-System wird der Sensor unter der Haut implantiert, die Glukosemessung erfolgt durch Einstrahlung von fluoreszierendem Licht. Der Sensor kann bis zu 180 Tage genutzt werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
Innovative Ansätze: Der Aufwand beim Wechsel der Nadelsensoren ist erheblich, und es passieren immer wieder Fehler dabei. Durch die Verwendung automatischer Applikatoren kann diese Prozedur vereinfacht werden, und sie läuft auch sicherer ab. Gut ist auch hinsichtlich Kosten und Müllvermeidung, wenn die Applikatoren mehrfach verwendet werden können.
Die Hersteller der CGM-Systeme bringen in relativ kurzen Zeitabständen neue Generationen ihrer Systeme auf den Markt. Üblicherweise verbessert sich mit jeder Generation die analytische Messgüte, die durch einen niedrigeren „MARD“-Wert angezeigt wird. Weiterhin wird durch neuartige Membranen auf den Glukosesensoren deren Empfindlichkeit auf Interferenzen mit bestimmten Substanzen reduziert (z. B. auf Paracetamol). Ebenfalls erfahren die Algorithmen zur Auswertung der gemessenen Glukosewerte eine ständige Verbesserung. Die Messergebnisse werden nicht nur an das Smartphone (oder die Armbanduhr) des Nutzers übermittelt, sie können, wenn der Nutzer damit einverstanden ist, auch weitergeleitet werden, z. B. an Eltern von Kindern mit Diabetes. Diese „Konnektivität“ kann auch dazu genutzt werden, die Messwerte an das Diabetesteam zu übermitteln, wenn dies sinnvoll erscheint.
Neuartige CGM-Systeme: Nachteile reduzieren
Es wird intensiv an einer Vielzahl neuartiger CGM-Systeme gearbeitet, um die Nachteile der bisherigen CGM-Systeme weiter zu reduzieren – das gilt für die Kosten, die Größe der Systeme (vor allem des Glukosesensors) oder um diskretere Messungen zu erreichen. Alle Medizinprodukte, die für ihre Nutzung auf eine Hautstelle aufgeklebt werden und dort für einige Tage verbleiben müssen, können zu Hautreizungen führen, das gilt für CGM-Systeme ebenso wie für Patch-Pumpen. Dabei können die Reizungen von diskreten Hautrötungen bis zu ausgeprägten und für die Patienten sehr störenden allergischen Reaktionen gehen. Hauptverursacher solcher allergischer Reaktionen scheinen Acrylate zu sein, die in den verwendeten Pflastern und Kunststoffgehäusen der Produkte enthalten sind. Hier gilt es, neue Lösungen zu finden, z. B. durch das Verwenden von Kunststoffen, die keine Acrylate enthalten. Da perspektivisch immer mehr Patienten immer mehr solche Produkte für längere Zeit am Körper tragen, muss solchen Aspekten ausreichende Aufmerksamkeit gewidmet werden, sonst blockieren die Hautreaktionen die Nutzung solcher technischer Optionen.
Was gilt es zu tun? Ein grundsätzliches Problem bei CGM-Systemen ist, dass es im Vergleich zu SMBG-Systemen, die seit vielen Jahren einen ISO-Standard haben, bisher keine Standards zur Beurteilung von deren Messgüte gibt. Dies ist im Hinblick auf das Etablieren eines neuen Parameters zur Beurteilung der Güte der Glukosekontrolle von Bedeutung: der „Time in Range“ (TiR), also jener Zeit während eines Tages, in der die Glukosekonzentration im Zielbereich (70 bis 180 mg/dl bzw. 3,9 bis 10,0 mmol/l) liegt. Dies wird von vielen Diabetologen als wichtiger zusätzlicher Parameter zum HbA1c-Wert betrachtet. Wenn aber die Güte der Messung dieses Parameters in einem relevanten Ausmaß von der Messgüte des verwendeten CGM-Systems beeinflusst wird – und nicht von der eigentlichen Glukosekontrolle –, stellt dies ein Problem dar.
Es wird intensiv an einer Vielzahl neuartiger CGM-Systeme gearbeitet, um Nachteile zu reduzieren.
Die amerikanische Gesundheitsbehörde (Food and Drug Administration, FDA) hat aktuell durch Einführung einer „i“-Markierung einen Schritt in Richtung Standardisierung getan; sie hat u. a. konkrete Vorgaben für die Messgüte gemacht, die ein solches System erfüllen muss – bislang hat nur ein rtCGM-System und ein iscCGM-System dies erreicht. Das „i“ steht für Interoperabilität, also für einen problemlosen Datentransfer und -austausch zwischen verschiedenen Systemen, wie sie für AID-Systeme (s. u.) notwendig sind. Durch diesen Schritt soll die Koppelbarkeit der Produkte von verschiedenen Herstellern verbessert werden, und Patienten können sich zukünftig ihr gewünschtes AID-System quasi in einer Art Baukastensystem selbst zusammenstellen. Ausgesprochen wichtig wäre eine Standardisierung auch in einer weiteren Hinsicht: In Krankenhäusern dürfen nur qualitätsgesicherte Methoden zur Glukosemessung eingesetzt werden und damit im Prinzip nur SMBG-Systeme. Wenn Patienten aber zunehmend mit CGM-Systemen ins Krankenhaus kommen, sind Konflikte programmiert.
Therapeutische Optionen – Pens/Smart-Pens
Stand der Dinge: In Deutschland nutzen fast alle Patienten Insulinpens und keine Spritzen mehr, was primär auf die weniger aufwendige Handhabung von Pens zurückzuführen ist. Mit den heute üblichen dünnen Kanülen ist die Insulininjektion in den meisten Fällen praktisch schmerzfrei. Was jedoch fehlte, war die Anbindung der Pens an das digitale Zeitalter: Wichtige Hinweise zur Realität der Insulintherapie der Patienten müssen immer noch händisch erfasst werden, z. B.: Wann wurde welches Insulin in welcher Dosis appliziert?
Innovative Ansätze: Aktuell kommen zunehmend „Smart-Pens“ auf den Markt. Vermutlich werden alle drei großen Insulinhersteller (Novo Nordisk, Lilly und Sanofi) bis Ende 2020 Smart-Pens im Angebot haben. Die Bereitstellung der Informationen zur Insulindosis, gepaart mit Glukosedaten und einer passenden Titrationssoftware, ist ein attraktiver Bereich für die Insulinhersteller und dabei vermutlich deutlich günstiger und weniger riskant als die Entwicklung eines neuen Insulins. Was können die Smart-Pens, und worin unterscheiden sie sich?
Was können Smart-Pens?
Smart-Pens sind Insulinpens, bei denen Insulinsorte, Insulindosis und Zeitpunkt der Applikation entweder in die Cloud hochgeladen werden oder per Bluetooth auf ein Smartphone und in eine App transferiert werden können und damit für weitergehende Auswertungen zur Verfügung stehen. Die technologischen Ansätze sind dabei recht unterschiedlich: Von aufsetzbaren Kappen oder Clips bis hin zu wiederverwendbaren eigenen Entwicklungen mit fest eingebauter Konnektivität wird es verschiedene Optionen geben. Zusammen mit Informationen zum Glukoseverlauf hilft dies beim Erkennen von Fehlern bei der Insulintherapie und kann für Therapiehinweise genutzt werden.
Pens: Wichtige Hinweise zur Realität der Insulintherapie der Patienten müssen immer noch händisch erfasst werden.
Bisher gibt es kaum Publikationen zu Smart-Pens. Damit fehlen Aussagen dazu, wie gut die Messung der noch im Insulinreservoir verbleibenden Insulinmenge de facto ist. Auch gibt es noch viele offene Fragen, zuallererst: Wann sind die Produkte verfügbar? Wie werden sie über die Zeit hinweg gepflegt in einer sich ständig verändernden App-Welt? Welche Partnerschaften etablieren sich zwischen pharmazeutischer und technologischer Welt? Eine weitere wichtige Frage wird sein: Was bevorzugen die Patienten? Entscheidend wird auch sein, wer in Anbetracht der damit verbundenen Kosten ein gutes Geschäftsmodell aufbauen kann. Die Bedeutung dieser Entwicklung ist durchaus als erheblich anzusehen. Diese innovativen Produkte werden hoffentlich vielen Patienten bei einer nachhaltigen Verbesserung ihrer Glukosekontrolle helfen.
Was gilt es zu tun? Es fehlen Belege für die Vorteile von Smart-Pens durch geeignet angelegte klinische Studien mit einem direkt vergleichenden Studiendesign zu konventionellen Pens. Auch bei diesen Produkten ist das Problem, dass der zeitliche Bedarf solcher Studien Jahre beträgt; bis deren Planung, Durchführung, Auswertung und Publikation erfolgt ist, gibt es mindestens eine – wenn nicht mehrere – neue Generationen des untersuchten Pens, was die Wertigkeit und Aussagekraft solcher Studien deutlich einschränkt.
Insulinpumpen/Patch-Pumpen
Stand der Dinge: Insulinpumpen sind eine zentrale Komponente von Systemen für eine automatisierte Insulindosierung (Automated Insulin Delivery, AID). Solche Pumpen sind inzwischen kleine, leicht zu bedienende und zuverlässige Geräte mit diversen Funktionen. Ein US-Hersteller neuer konventioneller Insulinpumpen (Tandem) kommt nun mit seinen Produkten auf den deutschen Markt; es bleibt abzuwarten, ob die Akzeptanz bei deutschen Patienten ebenso hoch ist wie in den USA.
Bei den Patch-Pumpen ist das Insulininfusionsset in der Pumpe integriert und damit für die Patienten nicht sichtbar. Insgesamt sind diese Pumpen deutlich kleiner und weniger auffällig und sehen nicht mehr nach einem Medizinprodukt aus. Dabei haben die verschiedenen Patch-Pumpen recht unterschiedliche Eigenschaften. Der Herstellungsaufwand und damit auch die Kosten bei den Patch-Pumpen ist nicht unerheblich, auch konkurrieren sie eher mit Insulinpens bzw. in Zukunft mit Smart-Pens als mit konventionellen Insulinpumpen.
Patch-Pumpen konkurrieren eher mit Insulinpens als mit konventionellen Insulinpumpen.
Ein Vorteil von Patch-Pumpen ist, dass sie an mehr Stellen am Körper angebracht werden können. Sie sind einfacher in der Nutzung, und der Einstich der Kanüle in das Gewebe erfolgt meistens automatisch. „Einfachheit“ ist für Patienten mit Diabetes eine wichtige Eigenschaft! Ein weiteres wichtiges Argument für Patch-Pumpen ist deren Diskretion, weshalb besonders Frauen diese gern nutzen. Bisher ist in Deutschland nur eine Patch-Pumpe verfügbar, dies in einer neuen Generation mit verbesserten Kommunikationseigenschaften. Sie wird insbesondere von Patienten genutzt, die vorher keine konventionelle Insulinpumpe verwendet haben. In Kürze sollen weitere Patch-Pumpen auf den Markt kommen. Aktuell scheinen 20 bis 25 % aller Pumpennutzer Patch-Pumpen zu verwenden, mit deutlich steigender Tendenz.
Innovative Ansätze: Die Verfügbarkeit von höher konzentriertem Insulin ermöglicht die Konstruktion von Insulinreservoirs mit andersartigen Abmessungen in den Patch-Pumpen, die eine Nutzung über einige Tage hinweg ermöglichen. Allerdings steigt dabei die Anforderung an die Genauigkeit der Insulininfusion und die Stabilität der Insulinformulierung. Bei U200-Insulin scheint dies gewährleistet zu sein.
Was gilt es zu tun? Auch bei Patch-Pumpen gibt es bisher erstaunlich wenige klinische Studien und Publikationen zur Evidenz von deren Nutzung, was aber offenbar für ihren Markterfolg wenig Bedeutung zu haben scheint. Auch bei Patch-Pumpen sind Hautirritationen ein Thema, welches in geeigneten Evaluierungen untersucht werden sollte.
Therapeutische Optionen – Insulininfusionssets
Stand der Dinge: Es gibt immer noch eine Reihe unklarer Aspekte bei der Insulinabsorption an der Spitze der Kanüle des Insulininfusionssets im subkutanen Gewebe – vor allem dazu, wie sich die Absorptionseigenschaften des Insulins in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer verändern. Weiterhin ist immer noch nicht klar, wie gut oder schlecht die Insulinabsorption ist, wenn die Kanüle in Hautareale mit Lipohypertrophien eingestochen wird.
Innovative Ansätze: Eine Option zum Erkennen von Insulininfusionssets, die nicht mehr geeignet funktionieren, kann die Analyse von CGM-Daten sein. Über die Zeit hinweg kommt es zu Veränderungen in der Insulinabsorption im subkutanen Fettgewebe, die zu signifikanten Anstiegen im Glukoseverlauf führen. Der Nutzer bekommt dann Hinweise zum Wechsel des Insulininfusionssets.
Von den verschiedenen Ansätzen, das Insulin durch „Microneedles“ direkt in die oberen Hautschichten zu applizieren, hat noch keins eine Produktreife erreicht. Dies gilt auch für die „Smart-Insuline“, die als Depot in das subkutane Gewebe appliziert werden und dort entsprechend der vorherrschenden Glukosekonzentration freigesetzt werden.
Was gilt es zu tun? Es sollten systematische Studien mit Insulininfusionssets initiiert werden, um die offenen Fragen zu klären, z. B. zu den Unterschieden in der Nutzungsdauer von Katheterkanülen aus Stahl vs. Teflon. Weiterhin wäre es interessant zu wissen, warum es zu erheblichen interindividuellen Unterschieden in der Nutzungsdauer von Infusionssets zwischen den Patienten kommt. Aktuell gibt es diverse Entwicklungsaktivitäten bei Insulininfusionssets der verschiedenen Hersteller mit dem Ziel, die Sets länger nutzen zu können, idealerweise ebenso lange wie CGM-Systeme, d. h. 10 bis 14 Tage. Solche Entwicklungen werden erschwert durch Substanzen, die bestimmten Insulinen zugesetzt werden und die mit den Plastikoberflächen in den Insulininfusionssets interagieren.
Systeme zur automatisierten Insulin-Dosierung (AID)
Stand der Dinge: Nach vielen Jahrzehnten, in denen immer wieder Systeme angekündigt wurden, die automatisch die Insulinzufuhr an den aktuellen Bedarf der Patienten anpassen, gibt es nun erste kommerziell verfügbare AID-Systeme: das MiniMed 670G von Medtronic, USA, und das DBGL1 von Diabeloop, Frankreich. Beide Systeme haben ein CE-Kennzeichen und dürfen in Europa vertrieben werden. Allerdings gibt es bisher nur für das System MiniMed 670G eine Nummer im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbands und damit eine Kostenerstattung. Gleichzeitig ist der Wunsch der Patienten nach AID-Systemen ausgesprochen groß: In den USA haben innerhalb eines Jahres gut 200 000 Patienten mit der Nutzung eines MiniMed-670G-Systems begonnen. Offenbar wurden aber viele Patienten nicht ausreichend im Einsatz eines solchen komplexen Systems unterwiesen und geschult, denn viele Nutzer haben dieses zurückgegeben. Dies kann auch auf den recht beachtlichen Handhabungsaufwand bei diesem System zurückzuführen sein, die häufigeren Kalibrationen und die vielen akustischen Hinweise und Alarme nerven die Patienten und deren Angehörige.
Urlaub – trotz beachtlichen Aufwands
Es ist eben nicht so, dass allein durch die Nutzung eines AID-Systems plötzlich alles automatisch geht und man seinen Diabetes de facto vergessen kann. Ein gut geschulter Patient kann aber durchaus Urlaub von seinem Diabetes machen, zumindest über weite Strecken des Tages.
Bisher decken AID-Systeme nur den basalen Insulinbedarf ab, die Insulininfusion wird fortlaufend auf Grundlage der von einem CGM-System gemessenen Glukosewerte angepasst. Den prandialen Insulinbedarf müssen die Patienten durch Abrufen von Insulinboli weiterhin manuell abdecken. Deshalb werden die AID-Systeme als Hybrid-AID-Systeme bezeichnet.
Innovative Ansätze: Einige weitere AID-Systeme sind in der klinischen Entwicklung soweit vorangeschritten, dass sie aller Voraussicht nach in den nächsten Jahren auf den Markt kommen. So wird schon die nächste Generation der AID-Systeme von Medtronic auch Korrekturboli automatisch abgeben. Weitere Generationen sollen eine automatische Insulinabdeckung von Mahlzeiten ermöglichen. Ebenfalls in späten Phasen der klinischen Entwicklung sind die „bi-hormonellen“ Ansätze: Bei diesen wird nicht nur Insulin infundiert, sondern auch Glukagon. Durch Gabe dieses „Gegenspielers“ von Insulin kann bei Gabe von zu hohen Insulindosen eine drohende Hypoglykämie verhindert werden.
Selbst wenn AID-Systeme zur Verfügung stehen, die den Insulinbedarf bei Mahlzeiten automatisch abdecken und durch Gabe eines zweiten Hormons Hypoglykämien noch sicherer verhindern helfen, kann damit keine völlige Normalisierung der Glukosekontrolle erreicht werden, denn die Insulinzufuhr erfolgt immer noch subkutan und nicht direkt in die Pfortader. Selbst wenn also auf absehbare Zeit keine vollständige „technische Heilung“ des Diabetes möglich ist, müssen sich die Patienten bei der Nutzung solcher AID-Systeme wesentlich weniger um ihre Insulintherapie kümmern. Sie können ein weitgehend normales Leben führen, ohne Angst vor akuten Stoffwechselentgleisungen haben zu müssen. Durch die damit mögliche bessere Glukosekontrolle sollte auch das Risiko für diabetesbedingte Folgeerkrankungen sinken. Neben solchen eher medizinischen Aspekten gilt es auch, die ausgeprägten positiven psychologischen Aspekte für die Patienten und deren Angehörige zu sehen, die mit dem Einsatz von AID-Systemen verbunden sind.
„DIY“: Viele wollen nicht mehr warten
Eine deutlich wachsende Gruppe von Patienten will nicht warten, bis ihnen das Gesundheitssystem Zugang zu AID-Systemen ermöglicht. Diese Patienten bauen sich ihr persönliches AID-System mithilfe von Bauanleitungen aus dem Internet und herunterladbaren Algorithmen, wir nennen diese Systeme „DIY – Do-it-yourself“. Problematisch dabei ist die rechtliche Situation: Patienten können natürlich solche DIY-AID-Systeme auf eigenes Risiko bei sich einsetzen. Da aber die verwendeten Geräte wie das CGM-System und die Insulinpumpe nicht entsprechend den Vorgaben für deren Zulassung benutzt werden, müssen die Hersteller für diese keine Haftung mehr übernehmen.
Die „Looper“ erreichen eine beachtlich gute Glukosekontrolle, allerdings kennen sie sich üblicherweise ausgesprochen gut mit ihrem Diabetes aus und wissen, wie sie die verwendeten Algorithmen optimieren können. DIY-AID-Systeme sind keine „App“, die man sich einfach herunterlädt – und schon kann man den Diabetes vergessen. In der Hand von erfahrenen und technikinteressierten Patienten ist dies eine interessante Option, aber nicht für die Vielzahl von Patienten, die eine andere Einstellung zu ihrem Diabetes haben.
Was gilt es zu tun? In Anbetracht dieser positiven Aspekte überrascht es, wie lange es gedauert hat, bis zumindest für ein AID-System eine Kostenübernahme erfolgt. Wie hoch die Kosten dafür am Ende sein werden, ist noch unklar. Für das System MiniMed 670G sollten sie nicht höher sein als die für die Insulinpumpen, die zwar eine Kommunikation mit einem rtCGM-System haben, aber keine automatische Regelung der Insulinzufuhr. Ein weiterer Aspekt ist die Evidenz für eine bessere Stoffwechselkontrolle, die sich mit dem Einsatz von AID erzielen lässt. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) treibt in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Diabetes & Technologie (AGDT) Bestrebungen voran, ein AID-Register in Deutschland aufzubauen, um darin regelmäßig definierte Parameter zu erfassen. Auswertungen sollen am Ende Hinweise zum Erfolg dieser therapeutischen Option liefern, z. B. darauf, bei welchen Patientengruppen diese Option am sinnvollsten eingesetzt wird. Dieses Register wird in der Praxis nur dann erfolgreich sein, wenn die dafür notwendige Finanzierung durch die Gesundheitspolitik zur Verfügung gestellt wird.
Elektronische Patientenakten
Stand der Dinge: Nach vielen Irrwegen soll es in Deutschland ab dem 01.01.2021 eine E-Akte geben. Die DDG arbeitet an der Entwicklung einer diabeteskompatiblen Ergänzung dazu, einer elektronischen Diabetesakte (eDA). Darin sollen die Daten möglichst aller Patienten mit Diabetes erfasst werden; es gilt abzuwarten, wie sich die eDA etablieren wird. In dem deutschen Programm Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation (DPV) für Patienten mit allen Diabetestypen, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche werden Daten zu praktisch allen Patienten gesammelt und regelmäßig analysiert sowie publiziert. Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen die Bedeutung solcher Datenbanken.
Innovative Ansätze: In den USA sind elektronische Patientenakten heute ein Teil des Behandlungsalltags; entsprechend gibt es regelmäßig Publikationen zu Datenauswertungen der gesammelten Datengebirge. In Deutschland werden die Daten von Patienten mit Diabetes z. B. auch bei den Disease-Management-Programmen in großem Stil erfasst; vor allem aus Datenschutzgründen liefern Auswertungen dieser Daten bisher aber nur wenige hilfreiche Aussagen.
Was gilt es zu tun? Wenn die eDA kommt, wird es spannend sein, zu sehen, wie sich diese etabliert und was die Auswertungen der darüber aggregierten Daten an praxisrelevanten Aussagen liefern.
Digitalisierung und Telemedizin
Stand der Dinge: Die Menge an Daten, die bei der Behandlung von Patienten mit Diabetes anfällt, ist heute schon beachtlich und wird vermutlich in Zukunft deutlich steigen. Im Zusammenhang mit den Begriffen künstliche Intelligenz und Big Data wird es darum gehen, sowohl die Behandler („Clinical Decision Support Systems“, CDSS) wie auch die Patienten („Patient Decision Support Systems“, PDSS) durch eine smarte Analyse der vorliegenden Daten geeignet zu unterstützen. Dabei werden die Daten aus den verschiedenen Geräten automatisch und ohne aktives Zutun der Patienten oder Ärzte heruntergeladen und an sicheren Stellen gespeichert.
Die Algorithmen sollen Muster in den Glukoseverläufen erkennen und konkrete Vorschläge für Therapieanpassungen machen. Als Datengrundlage können Blutzucker- sowie CGM-Profile dienen. Dabei sollen Behandler wie Patienten möglichst wenig mit der Datenerfassung und -auswertung zu tun haben, diese soll automatisch im Hintergrund ablaufen. Neben den zentralen Angaben zum Glukoseverlauf geht es um die Zusammenfassung aller weiteren verfügbaren Daten des jeweiligen Patienten – z. B. zu Körpergewicht, Essverhalten, anderer medikamentöser Therapie sowie dessen anderen Aktivitäten wie Sport. Unter Berücksichtigung der Daten vieler anderer Patienten, die in einer Datenbank vorliegen, und entsprechenden Leitlinien kommt es im nächsten Schritt zu einer intelligenten Gesamtbetrachtung und Analyse aller Daten. Im Zusammenhang mit einer „datenbasierten Diabetologie“ nutzen Patienten die Apps in ihren Smartphones, um sich Unterstützung z. B. bei der Bolusberechnung bei einer Mahlzeit zu holen.
Ab 01.01.2021 soll es in Deutschland eine E-Akte geben. Die DDG arbeitet an der Entwicklung einer diabeteskompatiblen Ergänzung dazu (eDA).
Innovative Ansätze: Eine wichtige Option für die Zukunft ist die telemedizinische Betreuung von Patienten: „Doc on demand“. In den Städten ist die Anzahl von Diabetologen noch ausreichend. Für Patienten aber, die auf dem Land wohnen, kann es eine längere Fahrt bedeuten, um von einem entsprechenden Spezialisten betreut zu werden. Für Patienten, die nicht mehr mobil sind, stellt Telemedizin ebenfalls eine klare Option dar. Auch in diesem Bereich sind die großen Hardware- und Softwarekonzerne hochaktiv, sie sehen in der Telemedizin eine attraktive Option für die Patientenbetreuung in der Zukunft. Durch entsprechende Änderungen bei gesetzlichen Regelungen und der Honorierung werden solche Ansätze heute auch von der Gesundheitspolitik unterstützt.
Was gilt es zu tun? Kein Diabetologe kann die Menge an neuen Informationen, die in diesem einen Forschungsbereich pro Tag veröffentlicht werden, noch überblicken. Nur durch den Einsatz entsprechender Datenbanken ist es möglich, bei einem gegebenen Patienten die relevanten Informationen unmittelbar zu finden. Im gleichen Sinne kann es hilfreich sein, die Daten von vergleichbaren Patienten zu berücksichtigen. Wenn die DDG und deren Fachleute bei der Interpretation solcher Informationen adäquat beteiligt werden, ist sichergestellt, dass medizinische Aspekte im Vordergrund stehen und keine anderen.
Zukunft
Mit der Verfügbarkeit des ersten AID-Systems wurde in 2019 ein wichtiger Schritt in Richtung „technischer“ Heilung des Typ-1-Diabetes gegangen. Insgesamt gibt es mehr an Entwicklungen für diese Patienten als für Patienten mit Typ-2-Diabetes. De facto wird praktisch täglich über neue Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung und Technologie bei der Diabetestherapie berichtet; ob alle davon wirklich relevant sind und sich im Behandlungsalltag wiederfinden, gilt es, abzuwarten. Bisher war die Diabetologie nicht immer „Front Runner“ bei neuen technischen Entwicklungen. Die treibenden Kräfte nehmen aber an Schwung zu, und der Druck zu Veränderungen steigt. Es wird gelten, die Balance zu finden zwischen der zügigen Implementierung „echter“ Innovationen versus überhasteter Nutzung von Scheininnovationen. Auch dies ruft nach kritischer Begleitung durch die DDG.
Autor:
Prof. Dr. Lutz Heinemann
Science-Consulting in Diabetes GmbH, Geulenstraße 50, 41462 Neuss

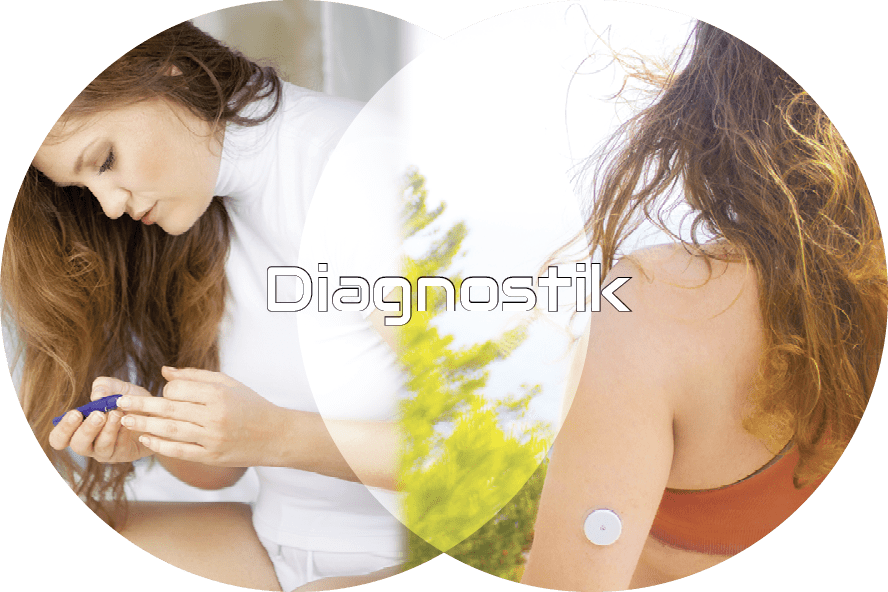
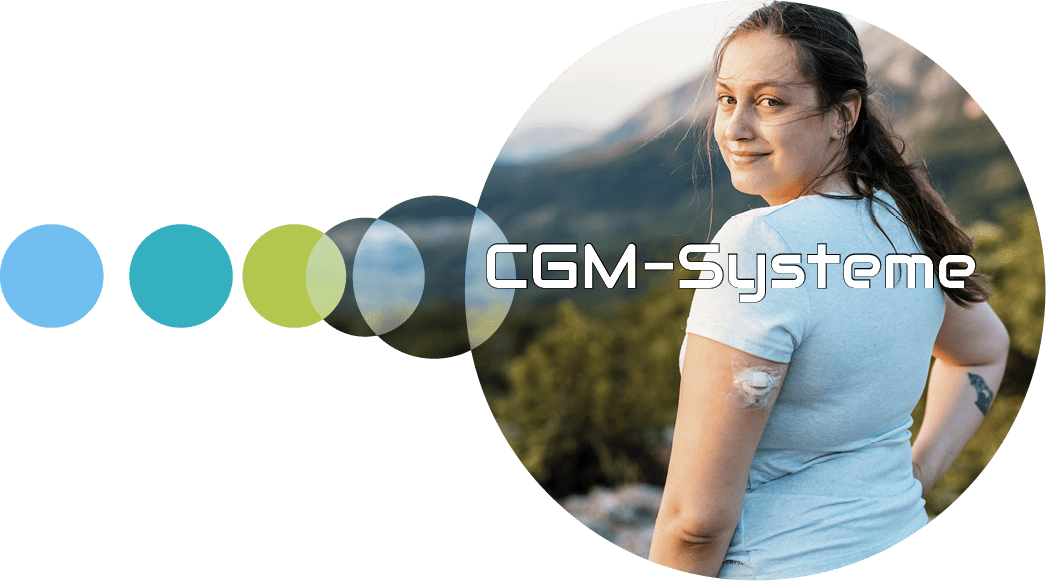


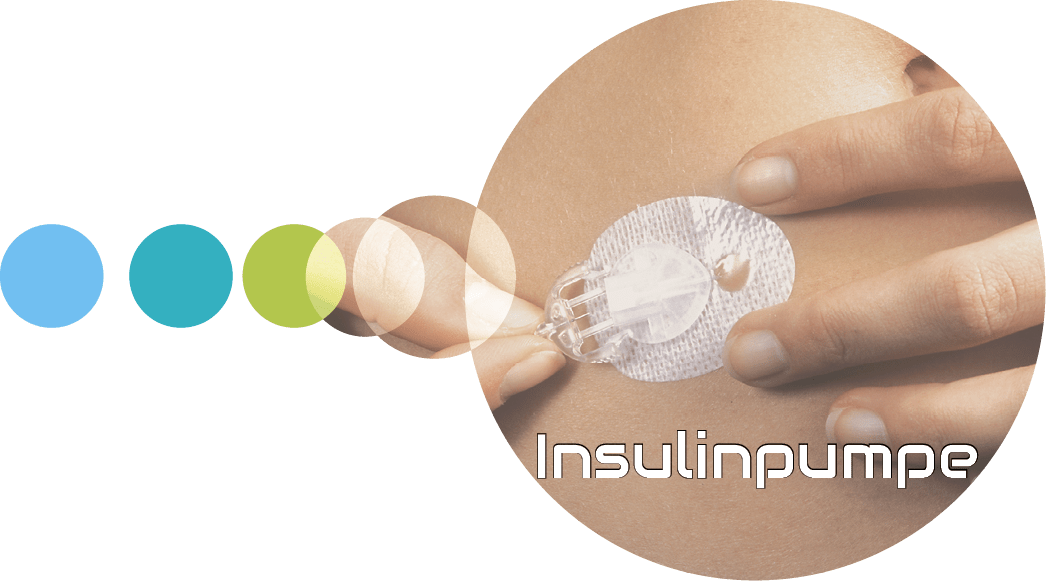

 TommL - iStockphoto
TommL - iStockphoto AdobeStock - greenbutterfly
AdobeStock - greenbutterfly