Prof. Dr. Andréa Belliger
Digital Diabetes Care – Das Phänomen jenseits von Diabetes- Apps und smarten Messgeräten
Während Digitalisierung den Fokus stark auf das Thema der Technologie legt, zielt der Begriff „digitale Transformation“ auf die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Veränderungen. Der Umgang mit Krankheit geschieht heute nicht mehr isoliert zwischen Arzt und Patient, sondern meist in einem komplexen Netzwerk unterschiedlichster menschlicher und nicht menschlicher Akteure.
Digitalisierung im Gesundheitswesen ist das Thema der Stunde. Der gesetzliche Rahmen für die sichere digitale Kommunikation ist in Deutschland seit Ende 2015 in Form des eHealth-Gesetzes in Kraft, Themen wie Telematikinfrastruktur, Stammdatenmanagement, elektronische Patientenakte, Videosprechstunden und Telefonkonsile wurden in den letzten Jahren in diversen Gesetzen niedergeschrieben, und langsam finden diese technologischen Entwicklungen Beachtung und Eingang in die Kliniken, Praxen und Labors und damit in den Alltag des ersten Gesundheitsmarktes. Kein Kongress, bei dem nicht Themen wie Data Driven Healthcare, personalisierte Medizin, eHealth, neue Ansätze in Forschung, Diagnose und Therapie und die Forderung nach einer neuen Innovationskultur im Gesundheitswesen auf der Agenda stehen. Viele dieser Themen befinden sich auf der Hype-Skala zwar weit oben und gehören eher in die Welt der Zukunftsvisionen denn in den tatsächlichen Alltag des real existierenden Gesundheitswesens. Dennoch: Dass sich unsere Gesellschaft gegenwärtig vor dem Hintergrund einer zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung grundlegend verändert, scheint Tatsache. Denn unabhängig und lange Zeit unbeachtet vom klassischen Gesundheitswesen hat sich, wenn es um die persönliche Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit geht, eine Art Paralleluniversum entwickelt: die Welt der vernetzten Bürger und Konsumenten, die Welt der ePatienten. Ein Paralleluniversum, das in den Möglichkeiten der Vernetzung gründet, neue Werte und Normen und damit neue Ansprüche hervorbringt und von dem eine starke transformative Kraft ausgeht, die das Gesundheitswesen, so wie wir es heute kennen, weit über technologische Innovation ziemlich auf den Kopf stellen wird. Und Tatsache ist: Diabetikerinnen und Diabetiker mischen hier ganz vorne mit.
Digital Diabetes Care – neuer Gesundheitsmarkt und neues Paradigma
Diabetes und Technologie sind seit jeher eng verbunden. In den letzten 40 Jahren haben sich die technischen Hilfsmittel enorm weiterentwickelt. Entstanden ist ein fast unüberschaubares Feld an Tools, Technologien, Soft- und Hardware, das sich „Digital Diabetes Care“ nennt. Digital Diabetes Care ist zu einem eigenen Gesundheitsmarkt und zu einem Vorreiter geworden, wenn es um zukunftsweisende Konzepte des Zusammengehens von Mensch und Technologie, der Integration von Technologie in Versorgungsprozesse, um neue, partizipative Formen des Miteinanders von Patienten und medizinischen Fachpersonen oder um neue Formen der integrierten Versorgung quer zu Professionssilos im Gesundheitswesen geht.
Es hat sich eine Art Paralleluniversum entwickelt: die Welt der vernetzten Bürger und Konsumenten, die Welt der ePatienten.
Die globalen Zahlen sind beeindruckend: 64 % aller mit Diabetes diagnostizierten Personen verfügten 2017 dem Digital Diabetes Care Market Report zufolge über ein Smartphone oder Tablet. Global sind also zwei Drittel aller Diabetes-Patienten digital erreichbar. Die Zahl der aktiven Nutzer digitaler Diabetes-Services beträgt jedoch lediglich 5 %. Das Potenzial ist riesig und das Smartphone etabliert sich als wichtigster Treiber für digitale Versorgung im Diabetesbereich.
Das Feld der digitalen Diabetesversorgung lässt sich ganz grob unterteilen in Apps (Software), Geräte (Hardware) und Dienstleistungen (Services).
Im Softwarebereich zeigt sich seit einiger Zeit ein Trend weg von der einzelnen App hin zu umfassenden patientenzentrierten Lösungen. Während Diabetes-Apps vor ein paar Jahren noch einfache Tools zur Verbesserung der „Health Literacy“ wie digitale Tagebücher waren, sind sie heute in der Regel umfassende Unterstützungslösungen für Diabetiker, die in der Lage sind, Informationen z. B. durch Vernetzung mit Fitnesstrackern zu kontextualisieren. Immer wichtiger wird, dass die Software interoperabel und offen, also mit diversen Geräten vernetzbar ist. Es sind nicht mehr die geschlossenen, proprietären Tools, die den Markt bestimmen, sondern jene, die offene Ökosysteme unterstützen. Patienten sind damit in Bezug auf konsistente Daten weniger abhängig von einem einzelnen Glukosemonitor oder einer Anbieter-App. Apps sind heute zudem viel stärker nutzer-, lifestyle- und ästhetikorientiert.
Immer wichtiger wird, dass die Software interoperabel und offen, also mit diversen Geräten vernetzbar ist.
Zentral sind die User Experience, das Design und neue Ansätze wie Gamification und die Visualisierung von Daten, damit die gesammelten und aggregierten Daten für Patienten tatsächlich auch zu handlungsrelevanter Information werden können. Diese Veränderungen und die Tatsache, dass die medizinische und ökonomische Effizienz und Effektivität durch klinische Studien belegt werden, führen dazu, dass die Vergütung durch Versicherungen wahrscheinlicher wird.
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der Hardware. Die Glukosemonitore, Pumpen und Insulinpens werden „smarter“, sie können Datenanalyse, Visualisierung, Alerts, haben ansatzweise prädiktive Funktionen und bieten Konnektivität zu anderen Sensoren und Apps. Ein verstärkter Fokus auf das Device-Design macht, dass die Geräte trendiger und stylisher aussehen. Der Patient wird zunehmend als Konsument angesprochen.
Bei den Dienstleistungen im Bereich von Digital Diabetes Care sind es in letzter Zeit vor allem die integrierten Diabetes-Plattformen (Dynamic Engagement Platforms), die auffallen. Auch sie stellen die „seamless integrated user experience“ ins Zentrum und verbinden über so genannte Bundles (Paketdienstleistungen) Diabetes-Apps mit vernetzten Geräten, Online-Zubehör-Shops, telemedizinischen Angeboten und Coaching-Dienstleistungen. Bundles scheinen das bisher erfolgreichste Businessmodell im Bereich von Digital Diabetes Care zu sein. Obwohl nur 5 % der Anbieter von Diabetes-Apps Bundles offerieren, generierten sie 2017 40 % aller Digital-Diabetes-Care-Einnahmen.
Viele neue Dienstleistungen im Bereich Digital Diabetes Care nehmen Trendthemen wie künstliche Intelligenz und Data Analytics auf. Während die aktuellen Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz im Diabetesbereich nicht weit über Mustererkennung und automatisierte Chatbot-Kommunikation hinausgehen, steht das Versprechen der Anbieter im Raum, künftig datengetriebene, personalisierte, einfach verständliche, prädiktive Echtzeit-Analytics liefern zu können.
Bundles scheinen das bisher erfolgreichste Businessmodell im Bereich von Digital Diabetes Care zu sein.
Ebenfalls in den Bereich der Dienstleistungen fallen neue Angebote im Bereich von Online-Coaching, Telemedizin, eKonsultation oder 24/7-Patientenmonitoring-Services. Ein weiteres Trendgebiet im Bereich der digitalen Diabetes-Dienstleistungen bilden die HCP-Lösungen, die als Digital-Diabetes-Kliniken oder Dashboard-Tools den medizinischen Fachpersonen Managementtools zur Verfügung stellen.
Von Digitalisierung zu digitaler Transformation
Neben dieser beeindruckenden Entwicklung der Integration von Technologie, der „Digitalisierung“ der Diabetesversorgung, rückt seit einiger Zeit auch das Thema der „digitalen Transformation“ in den Fokus. Während Digitalisierung eigentlich nichts anderes als die Übersetzung irgendwelcher analoger Werte in Bits und Bytes und damit eine eher technische Angelegenheit ist, bezeichnet digitale Transformation – ein Begriff übrigens, den wir erst seit etwa 2014 kennen – einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess, der weit über die Digitalisierung von Versorgungsprozessen, die Interoperabilität von Daten zwischen Leistungserbringern oder die Nutzung von digitalen Tools und Technologien an der Schnittstelle zu Patienten hinausgeht.
Zentrales Element digitaler Transformation als grundlegender gesellschaftlicher Veränderungsprozess bildet nicht Technologie, sondern Konnektivität. Mit Konnektivität ist weit mehr gemeint als technologische Vernetzung im herkömmlichen Sinn, mehr als der Zugriff aufs Internet oder die Nutzung von Social Media. Konnektivität meint vielmehr eine neue Art, uns als Gesellschaft aufzustellen und zu organisieren. Man könnte das ganz kurz und knapp überschreiben mit: Wir gehen weg von „Systemen“ hin zu „Netzwerken“.
Von Systemen zu Netzwerken
Auf die Frage, wie unsere Gesellschaft funktioniert, gibt es in den gegenwärtigen Sozialwissenschaften, etwas vereinfacht gesagt, zwei Theorien: Das eine ist die Systemtheorie, die davon ausgeht, dass soziale Ordnung als System verstanden werden kann. Die andere ist die Netzwerktheorie, die ihrerseits davon ausgeht, dass alle Formen von Ordnung als Netzwerkphänomene zu erklären sind. Diese Unterscheidung hat grundlegende und weitreichende Implikationen auf Funktionen, Rollen und Prozesse im Gesundheitswesen, denn die beiden Organisationsformen „System“ und „Netzwerk“ unterscheiden sich in einigen grundlegenden Punkten:
- Netzwerke geben keine Rollen und Funktionen vor
Jedes System – ob mechanisch wie eine Uhr, organisch wie der Körper oder sozial wie ein Spital – hat ein Organisationsprinzip, das drei Funktionen erfüllt: Es selegiert die Elemente, die zum System gehören, es relationiert, d. h. es setzt die Elemente zueinander in Beziehung, und es steuert. Die „Elemente“ des Systems, also die Rollen und Funktionen, sind vom System „konstruiert“. Ein Arzt ist ein Arzt, eine Pflegefachperson eine Pflegefachperson, ein Patient ein Patient. Sie haben bestimmte Funktionen und Rollen im System zu erfüllen. Netzwerke hingegen geben keine klaren Rollen und Funktionen vor. Eine Mutter eines chronisch kranken Kindes hat möglicherweise durch die intensive Auseinandersetzung mit dieser Krankheit, den Zugang zu Online-Information und den Austausch mit anderen Betroffenen in Online-Patientencommunitys, d. h. durch ihr Vernetztsein und die Möglichkeit, an Netzwerken zu partizipieren, mehr Wissen über diese spezifische Krankheit als der sie behandelnde Hausarzt. In vernetzten Gesundheitssettings werden die traditionellen, etablierten und ritualisierten Laien- und Expertenrollen zunehmend dysfunktional.
In vernetzten Gesundheitssettings werden die traditionellen, etablierten und ritualisierten Laien- und Expertenrollen zunehmend dysfunktional.
- Netzwerke haben keine Grenzen, sie sind offen und durchlässig
Jedes System ist auf eine Differenz zur Umwelt begründet und diese Differenz ist für jedes System konstitutiv. Systeme müssen für ihre Identität also klare Grenzen haben. Sie müssen wissen, wer dazugehört und wer nicht, beispielsweise wer gesund und wer krank ist, was ambulant und was stationär behandelt wird, welches Medikament oder Medizinprodukt zugelassen ist und welches nicht. Ein Spital als System betrachtet grenzt sich traditionellerweise klar ab von ambulanter Pflege, von niedergelassenen Ärzten, von Pflegeeinrichtungen oder einem Seniorenheim. Im Gegensatz zu Systemen haben Netzwerke durchlässige und unscharfe Grenzen. Für sie ist weniger wichtig zu wissen, wer oder was dazugehört, als zu wissen, wer mit wem verbunden ist. Ein Netzwerk differenziert sich von anderen Netzwerken nicht durch Grenzen, sondern durch die Intensität und Qualität der Kommunikationen. Für einen Diabetespatienten gehört deshalb seine aus Online-Freunden bestehende Diabetes-Community genauso zum Netzwerk wie seine Diabetes-Ärztin, seine Diabetes-Beraterin, sein Case-Manager bei der Versicherung und sein Blutzuckermessgerät. - Netzwerke sind komplex, heterogen und ständig im Wandel begriffen
Wandel, Heterogenität und Diversität sind in der DNA von Netzwerken zugrunde gelegt. Für ein Netzwerk entsteht Ordnung nicht wie bei Systemen dadurch, dass möglichst viel Komplexität durch zentrale Steuerung, klare Zielsetzungen, strenge Funktionalisierungen oder klare Prozessdefinition reduziert wird, sondern durch das Freisetzen der Kräfte der Selbstorganisation. Heterogenität, Diversität und Flow sind jene Prinzipien, die Netzwerke smart und innovativ machen.
Netzwerke lassen sich nicht top-down steuern. Ordnung entsteht in Netzwerken nicht top-down, sondern bottom-up.
- Netzwerke lassen sich nicht top-down steuern
Netzwerke lassen sich im Gegensatz zu Systemen nicht top-down steuern. Ordnung entsteht in Netzwerken auch, aber nicht top-down, sondern bottom-up, selbstorganisierend, emergent. Netzwerke wie traditionelle Organisationen managen oder steuern zu wollen, ist äußerst schwierig. Netzwerke erfordern neue Formen von Führung und Governance. Führungspersonen müssen sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass in Netzwerken permanent Interaktionen und Kräfte zur Wirkung kommen, die sich nicht nach den Organisationsmustern der Hierarchie richten. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Konnektivität und dem organisationalen Übergang von Systemen zu Netzwerken sind gegenwärtig neue Organisationsmodelle am Entstehen. Sie tragen Namen wie Soziokratie, Holokratie oder Adhokratie und bauen weit ab von klassischen Linienarchitekturen im Kern auf dezentrale, selbstorganisierte Teams und Strukturen. Das klassischste Beispiel für eine solche Netzwerkorganisation im Gesundheitswesen ist Buurtzorg, ein Versorgungs- und Arbeitsmodell, welches seit 2006 in Holland in der ambulanten Pflege angewendet wird. Das Buurtzorg-Modell basiert auf der Idee, dass eine Netzwerkorganisation gegenüber einem klassischen hierarchischen System viel besser in der Lage ist, Zufriedenheit unter den Pflegebedürftigen, Angehörigen und Mitarbeitenden, aber auch im sozialen Umfeld und bei den anderen Akteuren im Gesundheitswesen und der Gesellschaft zu bewirken. Buurtzorg richtet seinen Fokus konsequent auf die Bedürfnisse der Menschen aus. Die weit über 10 000 Mitarbeitenden arbeiten ganz ohne Manager in selbstorganisierten Teams von höchstens 12 Personen, die von lediglich 50 Mitarbeitenden im Bereich der zentralen Funktionen unterstützt werden. Menschlichkeit über Bürokratie. Evaluationen zeigen, dass sich dieses Netzwerkmodell positiv auf die Pflegequalität auswirkt und gleichzeitig die Motivation der Mitarbeitenden hebt. - Netzwerke haben eigene Werte und Normen
Konnektivität geht mit einer Reihe „neuer“ Werte und Normen, einer neuen Grundhaltung und einer neuen Organisations- und Branchenkultur einher. Patienten, Angehörige, aber auch Mitarbeitende wünschen sich heute offene Kommunikation, Transparenz und Partizipation. Patientenkommunikation soll offen, selbstkritisch, ehrlich und dialogbereit sein. Kommunikation mit Ärzten und vor allem Pflegepersonen wird in den meisten Studien als Hauptgrund für Patientenzufriedenheit genannt – und Patientenzufriedenheit wiederum als maßgeblicher Treiber für Health Outcome. In Europa wird diesem Thema langsam aber sicher mehr Beachtung geschenkt. Das Dresdner Sozialunternehmen „Was hab’ ich?“ übersetzt für Patienten kostenlos medizinische Berichte und Befunde in ein verständliches Deutsch und der Direktor des REshape Center an der Radboud-Universität in den Niederlanden hat an der eigenen Klinik eine neue Funktion, die des CLO, des Chief Listening Officers eingerichtet, dessen Aufgabe nichts weiter beinhaltet, als den Patienten, ihren Angehörigen, aber auch den Mitarbeitenden zuzuhören und die Learnings wieder in die Qualitätsprozesse der Organisation einfließen zu lassen. Zudem ist Transparenz gefordert: Wer heute als Einzelperson insbesondere in einer Führungsposition oder als Organisation nicht transparent ist, ist irgendwie suspekt. Und schließlich Partizipation: Patienten, Angehörige, aber auch Mitarbeitende möchten heute auf Augenhöhe kommunizieren und von Beginn an in Prozesse und Entscheide einbezogen werden.
Partizipation: Patienten, Angehörige, aber auch Mitarbeitende möchten heute auf Augenhöhe kommunizieren und von Beginn an in Prozesse und Entscheide einbezogen werden.
Gegenwärtig erleben wir in allen Gesellschaftsbereichen einen Übergang von Systemen hin zu Netzwerken. Und dies mit ziemlich weitreichenden Folgen. Die traditionellen Akteure befinden sich noch auf der Systemseite, während die vernetzten Patienten, Konsumenten und Bürger sich vermehrt in Netzwerken bewegen. Auch für viele Diabetes-Patienten geschieht der Umgang mit ihrer Krankheit längst nicht mehr isoliert zwischen Arzt und Patient, sondern in einem komplexen Netzwerk unterschiedlichster menschlicher und nichtmenschlicher Akteure, online wie offline, analog wie digital.
Digitale Transformation als Kulturthema
Im Kern ist digitale Transformation also ein Veränderungsprozess, der das Potenzial hat, nicht nur Technologien und Prozesse im Umgang mit Gesundheit und Krankheit zu verändern, sondern Organisationsstrukturen und vielleicht sogar die Kultur und den Mindset im Gesundheitswesen.
Technologien einzuführen, ist an sich relativ einfach, Haltungen und Kulturen zu verändern aber in keinster Weise. Kulturveränderung beginnt mit einer organisationsinternen oder noch besser einer branchenübergreifenden Vision, die Antworten liefert auf die Frage, wohin die gemeinsame Reise im Gesundheitswesen vor dem Hintergrund der digitalen Transformation als einem tief greifenden gesellschaftlichen Veränderungsprozess geht. Es geht dann um die Ableitung einer entsprechenden Strategie, um Überlegungen zu digitaler Governance oder ganz generell um kreative Ansätze, wie die Leidenschaft für Veränderung vor dem Hintergrund eines ständigen Wandels in der eigenen Organisation und im Gesundheitswesen mit all seinen vielfältigen Akteuren auf Dauer hochgehalten werden kann, wie das hochkomplexe Gesundheitssystem in einem sehr umfassenden Sinn agiler und menschlicher werden kann. Digitale Transformation ist deshalb nicht in erster Linie Aufgabe der IT, sondern eine Führungsaufgabe, da es im Kern nicht um die Implementierung neuer Hard- und Software, sondern um das Überdenken von Rollen und Kompetenzen, das Öffnen von Organisations- und Fachgrenzen, die intra- und interorganisationale Vernetzung, die Ermöglichung eines neuen „Mindset“ in der Organisation und Branche und das Initiieren von Leidenschaft für Veränderung geht. An verschiedenen Stellen im Gesundheitswesen zeigt sich bereits heute diese Veränderung des Mindsets und der Kultur.
Partizipative Forschung und Patienten als „Citizen Scientists“
Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation verändert sich zum Beispiel gegenwärtig auch medizinische Forschung. Der Ansatz partizipativer Forschung misst dem Patienten als „Citizen Scientist“ eine neue Rolle in der medizinischen Forschung zu. Ausgerüstet mit neuen Technologien, vernetzt in großen Communitys und mit der Möglichkeit, die eigenen medizinischen Daten ins Netz einzuspeisen, tragen Patienten bereits heute maßgeblich dazu bei, die Qualität und den Umfang medizinischer Forschung zu verbessern.
Der Ansatz partizipativer Forschung misst dem Patienten als „Citizen Scientist“ eine neue Rolle in der medizinischen Forschung zu.
Tatsache ist, dass allein über die Consumer-Genomics-Plattform „23andMe“ über 80 % der rund 10 Mio. Personen, die ihr Genom haben analysieren lassen, ihr Einverständnis dazu gegeben haben, dass ihre Genomdaten zu Forschungszwecken genutzt werden. Man spricht analog zur Organspende von „Data Donation“. Damit stehen – crowdsourced und cloudbased – ungeahnte Datenmengen für neue Forschungserkenntnisse zur Verfügung. Das Unternehmen TrialReach geht noch einen Schritt weiter und bietet eine Plattform, auf der sich Patienten, die an medizinischen Studien teilnehmen würden, und Wissenschaftler, die Patienten für Studien suchen, finden können. MedCrowFund ist ein interessantes niederländisches Projekt, bei dem Patienten als Partner – nicht nur als Datenlieferanten – in den ganzen Innovations- und Finanzierungsprozess medizinischer Entwicklungen eingebunden werden. Patienten liefern die Forschungsideen – sie sind schließlich die Experten, wenn es darum geht, mit einer spezifischen Krankheit zu leben –, sie suchen sich die zum Projekt passenden Forschenden aus und partizipieren an den Forschungsresultaten. Diese Art der Teilhabe geht weit über das persönliche Gesundheitsmanagement hinaus.
Patienten liefern die Forschungsideen, suchen sich die zum Projekt passenden Forschenden aus und partizipieren an den Forschungsresultaten.
Das Potenzial der Beteiligung von Patienten an Innovation und gemeinsamer Wertschöpfung im Sinne einer „value co-creation“ wird zunehmend ersichtlich. Crowdpower beschreibt, wie sich die Gesundheitsforschung aufgrund der technologiebasierten Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft verändert und wie Krankheiten möglicherweise mithilfe dieses gemeinsamen Efforts frühzeitig festgestellt, besser behandelt oder sogar verhindert werden können.
Neuer Umgang mit persönlichen Gesundheitsdaten
In der heutigen Gesellschaft ist ein neuer Umgang mit persönlichen Gesundheitsdaten erkennbar. Patienten, Bürger und Konsumenten haben keine grundsätzlichen Ängste, wenn es um die Digitalisierung ihrer Daten geht. Sie wollen aber eigenständig darüber verfügen, wer zu welchem Zweck Zugang zu diesen Daten hat. Studien zeigen, dass zwei Drittel der Patienten es begrüßen würden, wenn sie ihre Befunde, Röntgenbilder oder Laborwerte zu einer neuen medizinischen Ansprechperson mitnehmen könnten. Dieses Interesse nimmt übrigens mit steigendem Alter stark zu. Es zeichnet sich ab, dass von Patientenseite verstärkt der Druck kommen wird, medizinische Daten zugänglich zu machen und darüber hinaus endlich die Schnittstellen zwischen den Leistungserbringern zu öffnen, damit Kooperation und Koordination optimiert werden können. Dass die Daten im Besitz der Patienten sind und ihnen technisch wie politisch Zugang dazu gewährt wird, ist äußerst wichtig. Neue Technologien wie Personal Health Records (PHR) befähigen Patienten, Besitzer der eigenen Daten zu werden. Denn der beste Ort, Gesundheitsdaten zu zentralisieren, ist letztlich der Patient. Als Reaktion auf diese Forderung ist die „Blue Button“-Bewegung entstanden, die weltweit auf großes Interesse stößt. Ein blauer Downloadknopf auf der Website einer Klinik, eines Arztes oder eines Labors zeigt dem Patienten an, dass er seine medizinischen Daten anschauen, herunterladen und auf Wunsch in andere Applikationen integrieren kann. Aber eigentlich ist heute vom Gesundheitswesen und seinen Akteuren nicht nur technische Interoperabilität im Sinne des elektronischen Datenaustausches gefordert, sondern eine soziale und kulturelle Interoperabilität. Haltungen und Kulturen müssen zusammengeführt werden.
Open Data, Open Notes, Open Everything
Dass nicht nur Patienten im Sinne des „ePatient Crowdsourcing“ Offenheit leben und beispielsweise ihre Gesundheitsdaten der Forschung „spenden“, zeigt die OpenNotes-Initiative, die Patienten dazu einlädt, sämtliche Notizen und Informationen von Ärzten, Pflegepersonen und Labors einzusehen, um partnerschaftlich und besser informiert am Management der eigenen Gesundheit teilhaben zu können. Der englische NHS hat ein Programm gestartet, das den Patienten vollen Zugang zu den medizinischen Daten und NHS-akkreditierten Gesundheits-Apps gibt. Ein Beispiel für diesen Ansatz aus der Schweiz ist das webbasierte Patientendossier der Palliative Care in Solothurn. Der Betreuungsplan als Nahtstelle für die interdisziplinäre Behandlung der Patienten liegt beim Patienten, er bestimmt, wer Einsicht nehmen darf. Studien zeigen: Ärzte, die ihre ärztlichen Verlaufseinträge für ihre Patienten öffnen, stärken die Arzt-Patienten-Beziehung und das Vertrauen.
Ärzte, die ihre ärztlichen Verlaufseinträge für ihre Patienten öffnen, stärken die Arzt-Patienten-Beziehung und das Vertrauen.
Die Patienten übernehmen vermehrt Verantwortung für sich selbst und ihre Behandlung. Die Patientensicherheit verbessert sich. Eine partizipative Entscheidungsfindung wird gefördert. Und all dies kann erreicht werden, ohne dass die Arbeitslast der Ärzte steigt.
Carehacking – Hacking Health and Care
Patienten sind heute einerseits gezwungen, in einer immer komplexer werdenden Healthcare-Landschaft zu navigieren und immer mehr Kosten für die Gesundheit selbst zu übernehmen, andererseits sind sie aber auch gewohnt, sich im Netz zu informieren, sich online zu vernetzen und die eigenen Gesundheitsdaten und andere Datenquellen zu nutzen, um das Gesundheitssystem für ihre Zwecke zu nutzen. Diese Haltung und das Verhalten von Patienten haben bereits einen Namen erhalten: Carehacking. Dieser Begriff beschreibt, wie Gesundheitskonsumenten aufgrund des Zugangs zu digitaler Information und digitalen Tools auf teilweise überraschende Art und Weise die Kontrolle über ihre eigene Gesundheit übernehmen. Und es gibt bereits die ersten Carehacking-Helden: Hugo Campos, der nicht an die Daten seines Herzschrittmachers herankam, weil das Medtech-Unternehmen ihm diese als Patienten verweigerte. Oder der italienische Gehirnturmor-Patient Salvatore Iaconesi, dem vom Spital der Zugriff auf seine Patientendaten verweigert wurde und der als Informatiker kurzerhand die IT der Klinik hackte, seine Daten herausholte und sie ins Netz stellte, um Zweitmeinungen zum bevorstehenden chirurgischen Eingriff zu erhalten.
Viele Innovationen werden heute nicht in den traditionellen Life-Science-Unternehmen initiiert, sondern stammen aus Untergrundinitiativen.
Im Diabetesbereich hat sich rund um die US-Amerikanerin Dana Lewis eine Community und eine globale Diabetesbewegung mit dem Namen #WeAreNotWaiting gebildet, mit dem Ziel, ein von den Medtech-Unternehmen lange vernachlässigtes Tool, ein externes künstliches Pankreas-System, zu entwickeln. Viele Innovationen werden heute nicht in den traditionellen Life-Science-Unternehmen initiiert, sondern stammen aus Untergrundinitiativen, der DIY-Healthcare-Szene, der Biohacking-Community oder dem Maker Movement.
Partizipative Medizin und Shared Decision Making
Das Credo der Netzwerkgesellschaft lautet: Nicht Wissen und Information zu hüten, sondern Wissen und Informationen zu teilen, führt zu neuem Wissen. Wir teilen übrigens – z. B. unsere Bilder auf Facebook oder unsere Genomdaten – aus guten Gründen, nicht weil wir naiv oder exhibitionistisch wären. Wir teilen, weil wir einen Vorteil darin sehen. Teilen ist eine soziale Handlung: Sie verbindet uns, stellt Beziehungen her, bildet Vertrauen, Fremde werden zu Freunden. Eine neue Kultur des Teilens hat Einzug gehalten.
Das Credo der Netzwerkgesellschaft lautet: Nicht Wissen und Information zu hüten, sondern Wissen und Informationen zu teilen, führt zu neuem Wissen.
Die Zugänglichkeit zu Information und die Möglichkeit, sich zu vernetzen und zu teilen, verändern gegenwärtig die Rollen im Gesundheitswesen. Patienten sehen sich zunehmend weniger als passive Empfänger von Gesundheitsdienstleistungen, sondern als aktive und selbstbestimmte Kommunikationspartner, als Initianten von Präventionsmaßnahmen, Verantwortliche für Gesundheitsmonitoring und Manager von „home based care“ – als befähigt, kompetent und „empowered“. Damit rücken Konzepte in den Vordergrund, die die klassische Arbeitsteilung zwischen Experten und Laien, Health Professionals und Patienten aufbrechen. Partizipative Medizin und Shared Decision Making rücken in den Fokus. Die EU hat das Thema „partizipative Medizin“ mit dem Slogan „Putting patients in the driving seat“ schon früh auf ihren Aktionsplan der digitalen Agenda gesetzt.
ePatienten-Bewegung
Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation ist eine neue Generation von Patienten am Entstehen, die die Werte der vernetzten Welt, offene Kommunikation, Transparenz und Partizipation ins Zentrum stellt und sich selbst als ePatienten oder Superpatienten bezeichnet. Das kleine „e“ vor Patient steht nicht nur für „elektronisch“, sondern für educated, enabled, engaged und empowered – aktiv, befähigt, kompetent. Diese ePatienten sind mit ihren Werten und Forderungen zu einer neuen Einflussgröße auf dem Gesundheitsmarkt geworden.
Während Digitalisierung den Fokus stark auf das Thema der Technologie legt, zielt der Begriff „digitale Transformation“ auf die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Veränderungen.
Fazit
Die digitale Transformation verändert unsere Gesellschaft tief greifender als andere Veränderungsprozesse zuvor. Nachdem in den letzten Jahren in vielen Organisationen im Gesundheitswesen große Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung unternommen und viel investiert wurde in standardisierte Datenhaltung und die Nutzung neuer Technologien, rückt seit einiger Zeit das Thema der digitalen Transformation in den Fokus. Während Digitalisierung den Fokus stark auf das Thema der Technologie legt, zielt der Begriff „digitale Transformation“ auf die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Veränderungen.
Kernstück digitaler Transformation ist die „Konnektivität“, die zunehmende Organisation all unserer Lebensbereiche in Netzwerken. Wie in allen Gesellschaftsbereichen erleben wir auch beim Thema Gesundheit einen grundlegenden Paradigmenwechsel von „Systemen“ hin zu „Netzwerken“. Netzwerke sind bemerkenswerte Gebilde – sie geben keine Rollen und Funktionen vor, sind soziotechnisch, offen und durchlässig und nicht hierarchisch. Der Umgang mit Krankheit geschieht heute nicht mehr isoliert zwischen Arzt und Patient, sondern meist in einem komplexen Netzwerk unterschiedlichster menschlicher und nicht menschlicher Akteure. Und Netzwerke haben ihr ganz eigenen Werte und Normen: Konnektivität und Flow, Kommunikation, Transparenz, Partizipation, Authentizität und Empathie. An diesen Werten und Normen werden das Gesundheitswesen, Einzelpersonen wie Organisationen mit allen ihren Produkten, Dienstleistungen und Konversationen heute gemessen. Damit wird klar: Digitale Transformation ist nicht so sehr ein technologischer als vielmehr ein kultureller Transformationsprozess, bei dem Technologie lediglich als Katalysator wirkt. Digitale Transformation ist deshalb auch im Gesundheitswesen nicht in erster Linie Aufgabe der IT-Verantwortlichen, sondern eine Führungsaufgabe, da es im Kern nicht um die Implementierung neuer Hard- und Software, sondern um das Überdenken von Rollen und Kompetenzen, das Öffnen von Organisations- und Fachgrenzen, die intra- und interorganisationale Vernetzung, die Ermöglichung eines neuen „Mindset“ und das Initiieren von Leidenschaft für Veränderung geht. Das breite und vielfältige Feld von Digital Diabetes Care ist in dieser Beziehung wegweisend für andere Versorgungsbereiche. Diabetikerinnen und Diabetiker mischen hier ganz vorne mit.
Autor:
Prof. Dr. Andréa Belliger
Institut für Kommunikation & Führung IKF, Morgartenstrasse 7, CH-6003 Luzern

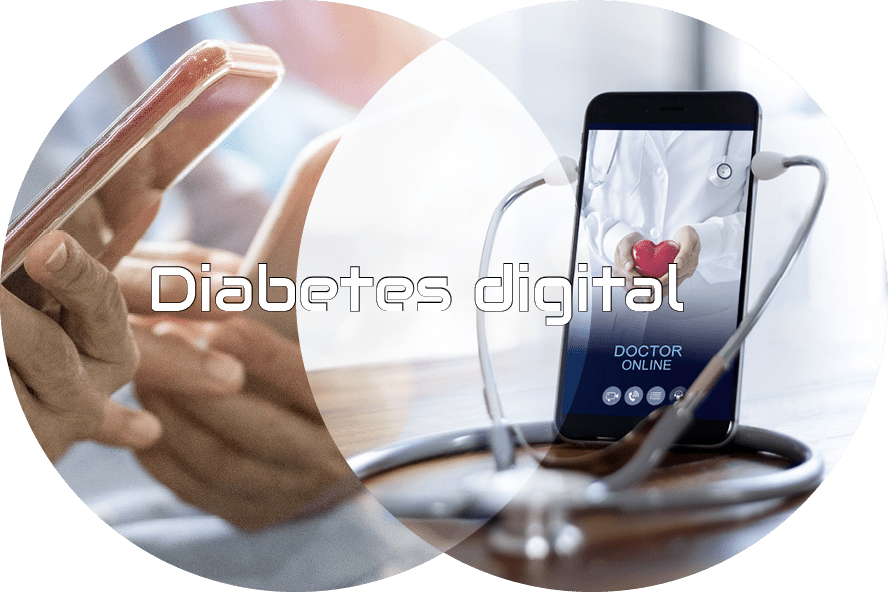


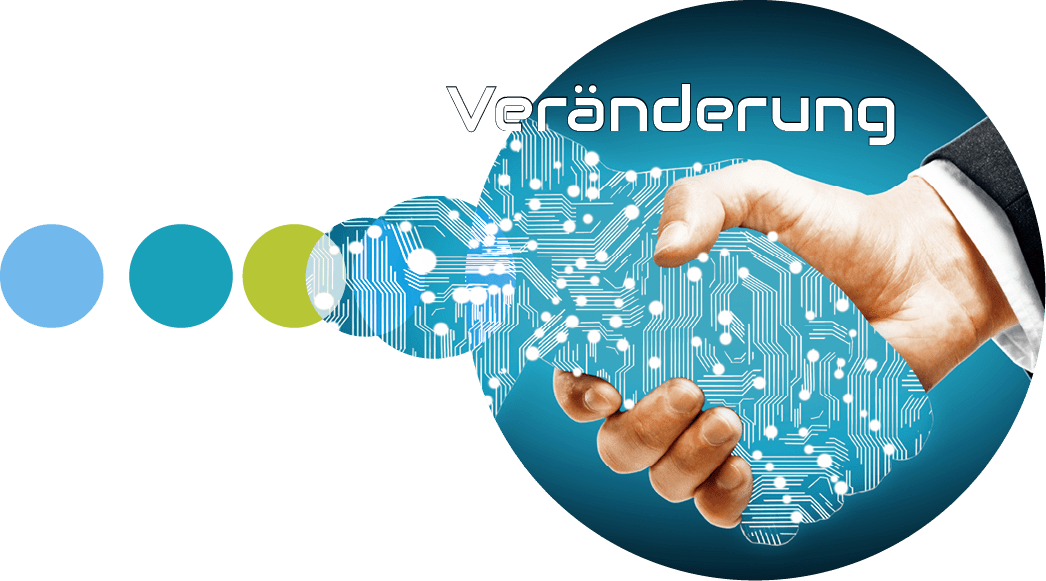

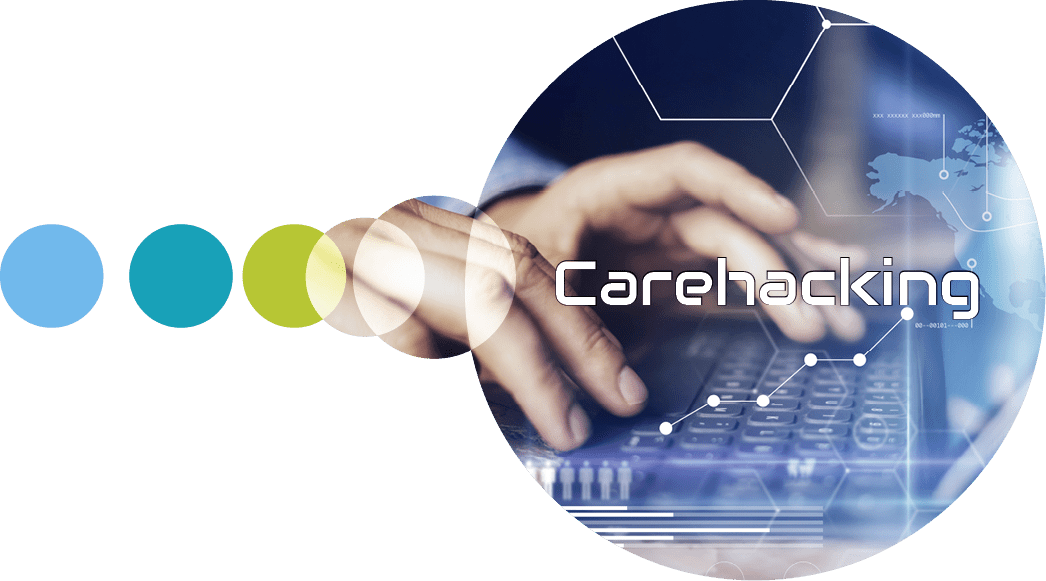
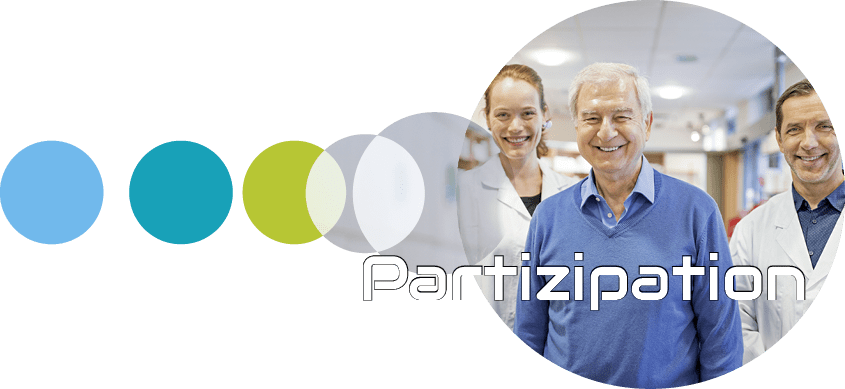
 AdobeStock - greenbutterfly
AdobeStock - greenbutterfly metamorworks - AdobeStock
metamorworks - AdobeStock